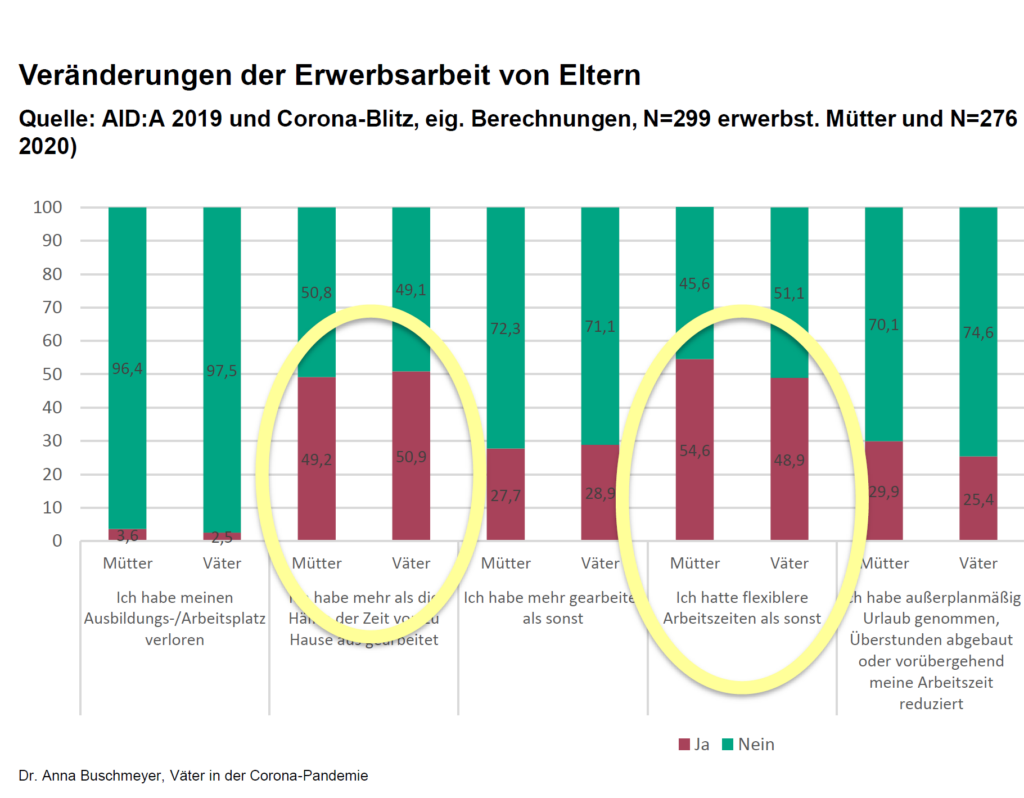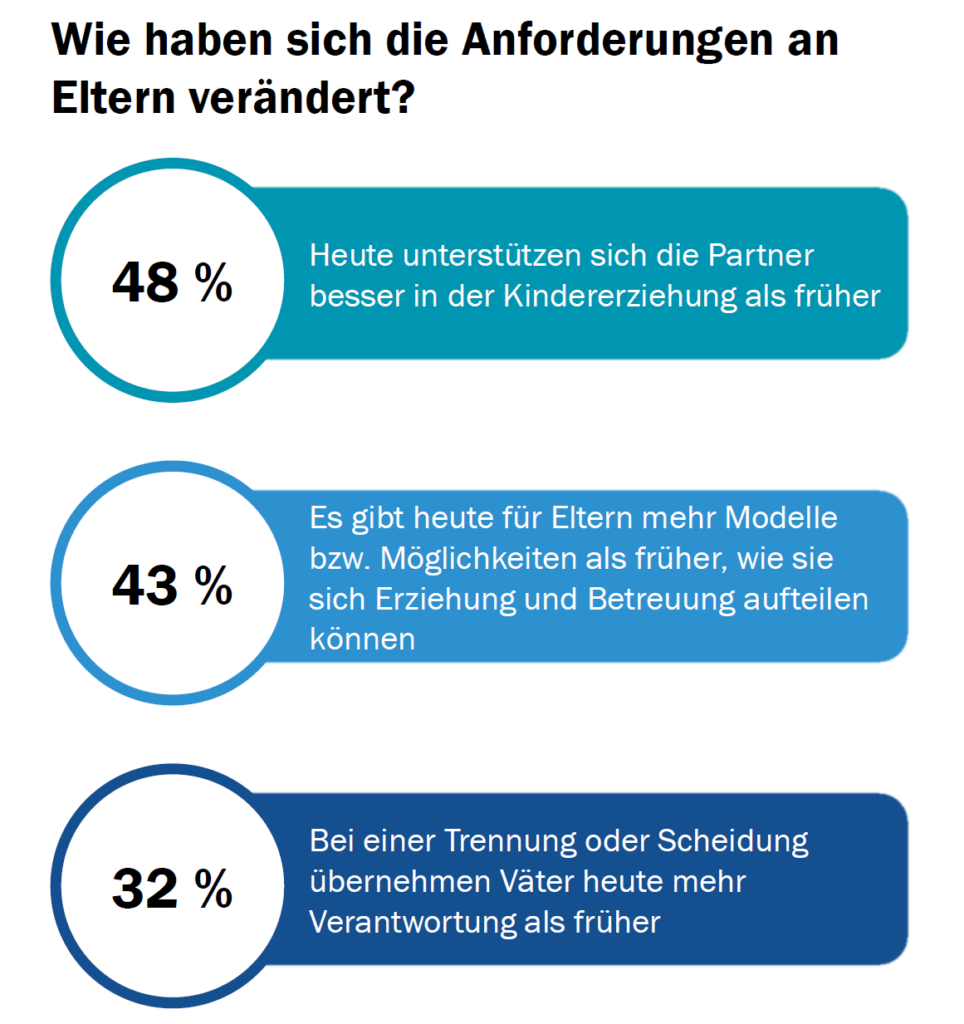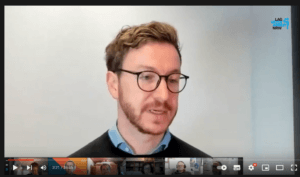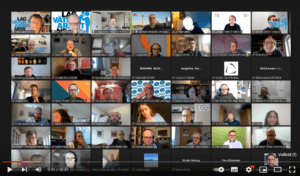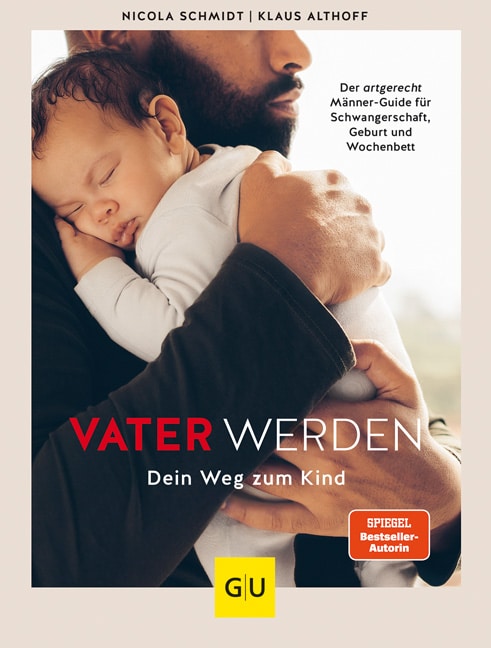Männer & Väter als Subjekte im Gleichstellungsprozess
Erstellt von Hans-Georg Nelles am Dienstag 18. Januar 2022
Holger, du hast bei der Fachtagung der LAG Väterarbeit in NRW im November die Dialogrunde und den Workshop im Themenfeld ‚Gleichberechtigung und Beteiligung‘ moderiert. Eine der Visionen die in der Dialogrunde formuliert wurde lautet: ‚Familienarbeit aus der Tabuzone holen‘. Was ist damit gemeint?
Im gesellschaftlichen Kontext gehen wir vom Idealbild der heilen Familie aus, ein Ort von Liebe und Geborgenheit. Treten Probleme und Herausforderungen auf, werden diese schnell individualisiert und stehen in Verantwortung der Eltern. Dann gibt es Aussagen wie: „Die Eltern sind überfordert sie sollen sich doch Hilfe holen.“ Im unternehmerischen Kontext soll Familienarbeit idealerweise funktionieren und nicht den Arbeitsprozess stören.
Schlaflose Nächte bei zahnenden Kindern, Erkrankungen, neue Lebensabschnitte oder auch die Zeit der Pubertät sind jedoch ganz normale Familienthemen, die in der Regel viel Kraft und elterliche Aufmerksamkeit benötigen. Konkret geht es darum, dass Kolleginnen nicht ausgegrenzt und belächelt werden, wenn sie aufgrund von Aufgaben mit und für die Kinder eher gehen müssen oder die familiären Themen über berufliche Aufgaben stellen.
Ebenso sind Themen wie Allein- bzw. Getrennterziehende oder Trennung keine, mit denen man im Arbeitsalltag oder auch im Freundeskreis punkten kann, wenn Familie und Familienarbeit zur besonderen Herausforderung wird. Unsere Gesellschaft verweist lieber an individuelle Unterstützungsangebote, als dass strukturelle Veränderungen angedacht und auf den Weg gebracht werden.
Nicht zuletzt gehört Familien- und Care-Arbeit nach wie vor zu den unentgeltlichen Leistungen, die für eine Gesellschaft zwar unabdingbar sind, aber eben nicht finanziert und entsprechend anerkannt werden. Nicht zuletzt sehen wir im Umgang mit Familien während der Pandemie, dass zwar Trostpflaster verabreicht werden, wie einmalige Zahlungen, aber dass wir viel mehr über Wirtschaft und Finanzen berichten, als dass die herausfordernde Familien- und Sorgearbeit in den Mittelpunkt gerückt werden. Ebenso ist das Lohngefälle ein Ausdruck dafür, welchen Wert Sorgearbeit in unserer Gesellschaft hat und wie selbstverständlich sie in diesem Lohngefälle gegenüber produzierendem Gewerbe gehalten wird.
Warum ist es wichtig, Männer und Väter von Anfang an als Akteure im Gleichstellungsprozess zu adressieren und einzubeziehen?
Weil Gleichstellung nur im Miteinander und im für einander Einstehen gelingen kann. Equal Pay und Equal Care sind Aufgaben, die längerfristig Müttern wie Vätern zugutekommen. Rollenklischees entwickeln sich, sobald wir auf die Welt kommen und prägen unsere Gesellschaft nachhaltig. Wenn wir daran etwas ändern wollen, dann müssen wir an individuellen Einstellungen etwas verändern und bei den frühen Sozialisationsinstanzen starten. Kinder müssen erleben können, dass Väter im Alltag anwesend sind und sich ebenso um Kinder kümmern, wie sie ihre bezahlte Arbeit meistern. So braucht es in allen Lebensbereichen männliche Vorbilder, die ein gleichberechtigtes Leben ohne Rollenzuschreibungen anstreben oder bereits realisiert haben. Und hierfür braucht es Männer und Väter die dies auch leben wollen, also davon überzeugt sind, dass dies für sie und für die nachfolgende Generation ein guter Weg ist, Gesellschaft zu gestalten. Oft erleben heute Männer Gleichstellung als Beschneidung von Möglichkeiten, als Zurechtweisen und defizitär. Dabei gilt es das Augenmerk darauf zu legen, was Männer und Väter von diesem Prozess ganz individuell und im Zusammenleben mit Frauen und Müttern davon haben.
Welche Vorteile bringt das für Väter und die Beziehung zu ihren Kindern?
Es bringt Stabilität für die Beziehung, wenn Väter nicht nur im Spaßbereich erlebt werden, sondern auch zeigen dass sie im Carebereich fit sind. Viele Väter, die Elternzeit genommen haben, berichten davon, dass sie später eine gute Beziehung zu ihren Kindern haben. Zum einen ist dies natürlich in der Begleitung im Aufwachsen der Kinder eine wichtige Ressource. Aber ich denke zudem ist es eine wichtige Energiequelle für Väter selbst, wenn sie am Werden ihrer Kinder beteiligt sind und durch Beziehung zu ihnen gestärkt und getragen werden. Nicht zuletzt verhindert es soziale Isolation, insbesondere in Krisen & Konfliktsituationen.
Welche Stolpersteine und Widerstände gilt es dabei unbedingt zu beachten?
Väter sind, wenn es um Familien- und Carearbeit geht, in einem für sie noch relativ neuen Lebensbereich unterwegs. Es fehlt an Erfahrungen und Angeboten. Häufig bekommen sie direkt oder durch die Blume gesagt, dass die Mütter hier die bessere Arbeit leisten. Als Beispiel sei ein Vater genannt, der in der Familienberatung bei der Umgangsgestaltung danach gefragt wurde, ob er für seine Kinder sorgen könne. Dieser Vater hatte ein Jahr Elternzeit genommen. Als er die Frage bejahte, kam die nächste Rückfrage, was er denn für seine Kinder koche? Diese subtilen Kontrollfragen sind verunsichern Väter zusätzlich und zeigen ein fehlendes Zutrauen. Väter brauchen jedoch offene und vertrauensvolle Rahmenbedingungen, um sich noch mehr in den Care- und Sorgebereich einzubringen.
Wahrscheinlich stehen sich jedoch die Männer im Gleichstellungsprozess am meisten selbst im Weg, wird das Thema Gleichberechtigung mit „schwach sein“ verknüpft und innerlich abgewertet. Auf der anderen Seite braucht es natürlich auch Mütter und Frauen, die Veränderungen aushalten, insbesondere, wenn sie nicht nach ihren Ideen umgesetzt werden. Wichtig ist dabei, dass ein Austausch miteinander stattfindet und mögliche Stolpersteine gemeinsam aus dem Weg geräumt werden können.
Nicht zuletzt ist es Aufgabe der Politik, den gesellschaftlichen Umdenkprozess zu forcieren und zu unterstützen. Väter und Männer aktiv hierzu einzuladen und dafür strukturelle Rahmenbedingungen zu schaffen.
Was sind deiner Meinung nach die ersten drei Schritte auf dem Weg hin zu einer ‚echten‘ Gleichberechtigung in den Sphären Erwerbs- und Carearbeit?
Die Rahmenbedingungen dafür zu schaffen, dass Männer nicht mit dem Gedanken des Familienernährers aufwachsen, also als hauptverantwortlich in die Erwerbsarbeit gedrängt werden und dass Vereinbarkeit von Familie und Beruf aktiv von Unternehmen angesprochen und Vätern Mut gemacht wird, sich auszuprobieren, den Bereich von Sorgearbeit zu entdecken und sich selbst zu zeigen.
Themen, wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf müssen auf Männer und Väter direkt zugeschnitten werden, auch wenn es dieselben Inhalte betrifft. Solange wir in traditionellen Rollenvorstellungen verhaftet sind, braucht es aktive und manchmal provokative Anstöße zum Umdenken. Role-Model-Kampagnen können dabei positive Denkanstöße liefern und eine Vielfalt aufzeigen, die ganz unterschiedliche Väter anspricht.
Frauen in den Vorstandsetagen sind dabei ebenso wichtig, wie Väter in einer Elternzeit von sieben Monaten und mehr. Die Elternzeit- und Elterngeldreform 2007 hat gezeigt, dass strukturelle Anreize Veränderungen wunderbar beschleunigen können. Hier kann Politik entsprechend unterstützend wirken.

Holger Strenz ist Vater von 2 Töchtern, Sozialpädagoge, Systemischer Paar- und Familientherapeut. Er ergründet, untersucht und beforscht das männliche Geschlecht seit über 25 Jahren und versteht sich als Netzwerker, der mit Papaseiten.de Väterarbeit in Dresden und in Sachsen einen Weg bahnt. Seit über 15 Jahren geschieht dies innerhalb der Gleichstellungsarbeit. Er ist Mitglied der Fachgruppe Väter im Bundesforum Männer und im Väterexpertennetz Deutschland e.V. Aktuell koordiniert er die Kampagne zur Petition „10 Tage Vaterschaftsfreistellung* zur Geburt“.
Abgelegt unter Interview, Partnerschaft | Keine Kommentare »