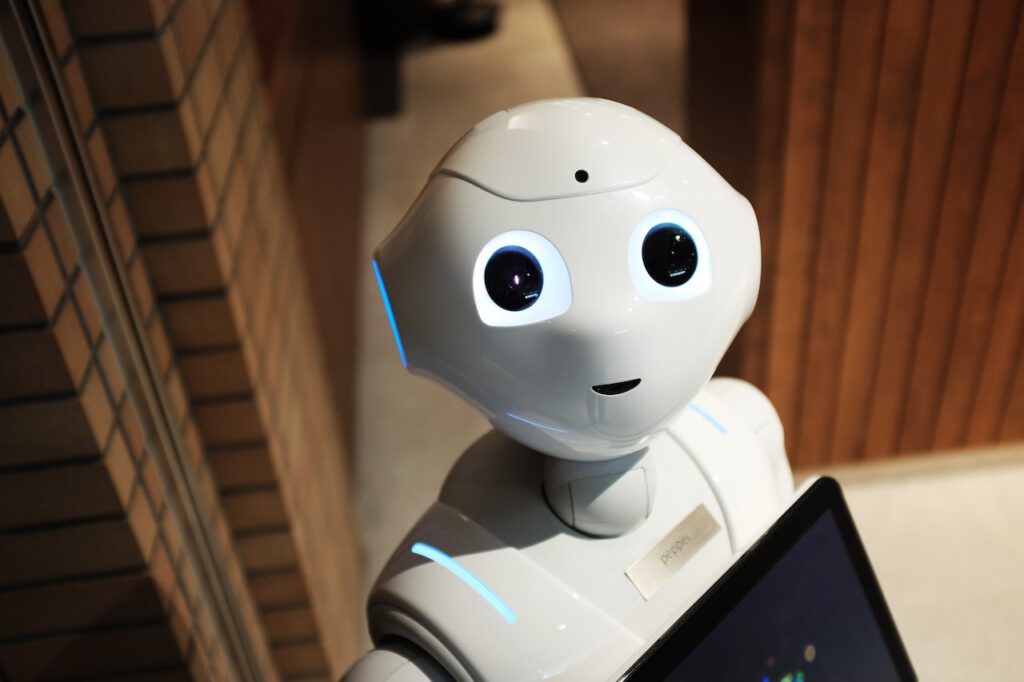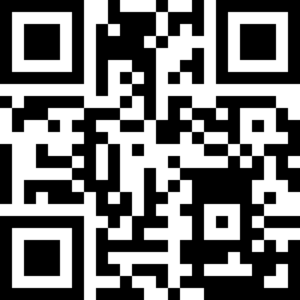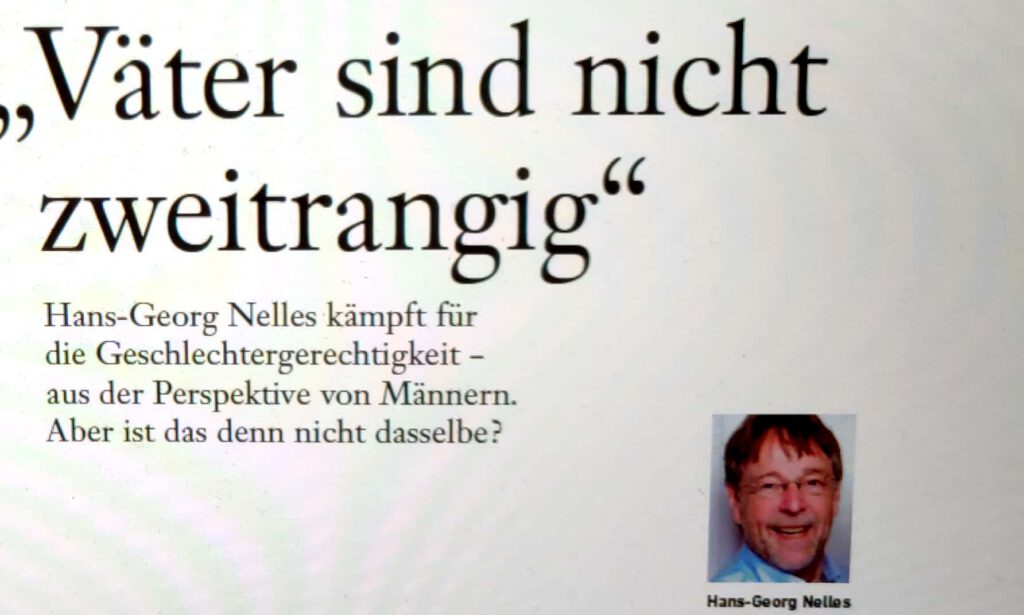Care.Macht.Mehr – Von der Care-Krise zur Care-Gerechtigkeit
Erstellt von Hans-Georg Nelles am 28. Februar 2023
… lautete vor 10 Jahren der Titel eines Manifests, mit dem sich 23 Wissenschaftler*innen an die Öffentlichkeit gewandt haben. Sie sahen den Zusammenhalt der Gesellschaft, der über wechselseitige Sorge gewährleistet wird, gefährdet. „Care in allen Facetten ist in einer umfassenden Krise. Hierzu gehören unverzichtbare Tätigkeiten wie Fürsorge, Erziehung, Pflege und Unterstützung, bezahlt und unbezahlt, in Einrichtungen und in privaten Lebenszusammenhängen, bezogen auf Gesundheit, Erziehung, Betreuung u.v.m. – kurz: die Sorge für andere, für das Gemeinwohl und als Basis die Sorge für sich selbst, Tag für Tag und in den Wechselfällen des Lebens. Care ist Zuwendung und Mitgefühl ebenso wie Mühe und Last. Gleichwohl ist Care keine Privatangelegenheit, sondern eine gesellschaftliche Aufgabe. …“

Ihrer Auffassung nach hat sich die Gesellschaft seit den 1970er Jahren hin zur flexibilisierten und globalisierten Dienstleistungs- und Wissensgesellschaft verändert. Die Organisation und Zuweisung von Care-Aufgaben spiegeln jedoch noch ihre historische Entstehung während der Industrialisierung im 19. Jahrhundert.
Care wurde Frauen zugewiesen, abgewertet als ihre scheinbar natürliche Aufgabe, unsichtbar gemacht im privaten Raum der Familie oder unterfinanziert und semi-professionalisiert im sozialen Bereich organisiert.
Erschwerend komme hinzu, dass die Care-Krise, die von der aktuellen neoliberalen Politik verschärft wird, immer nur an einzelnen Stellen aufscheint: wenn Frauen und Männer versuchen, individuell und oft mit großer Anstrengung, strukturelle gesellschaftliche Probleme zu bewältigen.
Die Autorinnen des Manifests forderten dazu auf, alternative Care-Modelle zu entwickeln und gesellschaftlich-politische Veränderungsprozesse anzustoßen, die sich an umfassenden Vorstellungen von Gerechtigkeit und einem guten Leben orientieren: „Hierfür müssen Politik, Unternehmen und Verbände – auch in transnationaler Perspektive – anfangen, Care-Bedarfe als grundlegende gesellschaftliche Aufgabe im Zusammenhang wahrzunehmen, statt Einzellösungen zu entwickeln. Denn über Care wird zwar vielerorts geredet, aber die Diskussionen nehmen bislang weder disziplinär noch politisch oder normativ aufeinander Bezug.“
Es ging für sie auch darum, „Fürsorglichkeit und Beziehungsarbeit neu bewerten, unabhängig von traditionellen Geschlechterbildern. Im Zentrum einer fürsorglichen Praxis steht privat wie professionell die Beziehungsqualität. Menschen sind aufeinander angewiesen und brauchen persönliche Beziehungen. Care stiftet damit individuelle Identität und schafft gemeinschaftlichen Zusammenhalt.“
Ihr Fazit: „Wir brauchen eine neue gesellschaftliche Kultur, in der die Sorge für sich und andere einen eigenständigen Stellenwert bekommt, unabhängig davon, ob eigene Kinder oder Eltern zu versorgen sind. Wir brauchen neue Wege der Bereitstellung, Anerkennung, Aufwertung und Bezahlung wie auch der gesellschaftlichen Organisation von Care-Arbeit auf lokaler, nationaler und transnationaler Ebene.“ Das ist vor 10 Jahren formuliert worden.
Morgen, am 1. März ist der ‚Equal Care Day‘. Dieser wird seit 2020 von dem gemeinnützigen Vereins klische*esc e.V. durchgeführt. Der Tag soll „kein Anlass für Blumen- und Pralinen-Geschenke, sondern eine Initiative sein, die den Druck kontinuierlich hochhält und dafür sorgt, dass das Thema ‘Equal Care’ nicht mehr aus der politischen Debatte verdrängt werden kann.“
Im Rahmen des ersten ‚Equal-Care-Day‘ am 29. Februar 2020 ist ebenfalls ein Manifest entstanden. Dort heißt es unter anderem:
„Wir alle sind in unserem Lebensverlauf auf die fürsorgliche Zuwendung
und Versorgung anderer angewiesen: Das gilt für Neugeborene ebenso wie
für Kinder im Vor- und Grundschulalter, aber auch als junge Erwachsene,
als Berufstätige, bei Krankheit oder Behinderung und schließlich als
ältere Menschen profitieren wir im Alltag immer wieder von der
Care-Arbeit anderer; Gesundheit, Wohlbefinden, Lebensqualität und
gesellschaftliches Miteinander hängen davon ab.
Diese Care-Arbeiten und die Mental Load werden vor allem von Frauen und Mädchen getragen – unbezahlt oder unterbezahlt. Dadurch bleibt ihnen weniger, manchmal gar keine Zeit für Erwerbsarbeit, zur Aus- und Fortbildung, und sie verfügen deshalb über weniger oder kein eigenes Einkommen. Weltweit übernehmen Frauen täglich mehr als 12 Milliarden Stunden unbezahlte Sorgearbeit. … Würden diese auch nur mit dem Mindestlohn bezahlt, würde … das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands um circa ein Drittel höher ausfallen, als in den bisherigen Gesamtrechnungen ausgewiesen wird. Aber private Care-Arbeit spielt für diese ökonomische Kennziffer, die als ‚Wohlstandsmaß’ einer Nation gilt, keine Rolle, dabei ist sie das Fundament jeglichen Wirtschaftens.“
Im weiteren Verlauf des Manifests geht es um die individuelle Verteilung der Care-Aufgaben, die Beseitigung des ‚Mental Load‘. Die Bundesregierung wird im letzten Abschnitt aufgefordert, passende gesetzliche Rahmenbedingungen herzustellen und „sich weltweit für die ideelle und finanzielle Anerkennung und eine faire Verteilung von Sorgearbeit stark zu machen.“
Diese Einengung der 2013 manifestierten umfassenden Care-Krise auf die traditionelle geschlechtsspezifische Arbeitsteilung wird von dem im Juli 2020 haben gegründeten zivilgesellschaftliche Bündnis „Sorgearbeit fair teilen“ noch weiter zugespitzt.
„Die ökonomischen und sozialen Folgen dieser traditionellen Arbeitsteilung sind schwerwiegend: Frauen gehen sehr viel häufiger Teilzeitbeschäftigungen nach und ihre Einkommen sind oft deutlich niedriger als die von Männern. Die beruflichen Entwicklungsperspektiven von Frauen sind entsprechend vielfach begrenzt und bei Trennung oder im Alter sind sie finanziell nicht ausreichend abgesichert. Männern fällt noch immer überwiegend die Rolle des Familienernährers zu. So fehlt ihnen neben der Erwerbstätigkeit oftmals die Zeit, Sorge- und Hausarbeit zu übernehmen. Diese Arbeitsteilung entspricht allerdings nicht mehr den Lebensvorstellungen vieler heterosexueller Paare. Viele Frauen und Männer wollen sowohl Sorgearbeit und Sorgeverantwortung übernehmen als auch den eigenen Lebensunterhalt verdienen können.“
Das Bündnis befindet sich in Trägerschaft des Deutschen Frauenrats und die Geschäftsstelle wird vom BMFSFJ finanziert. Das Ziel des Bündnisses ist es, „dass Geschlechterstereotype abgebaut und Rahmenbedingungen geschaffen werden, die allen Menschen die gleichen Verwirklichungschancen und die Vereinbarkeit von Sorge- und Erwerbsarbeit über den gesamten Lebensverlauf hinweg ermöglichen.“
Die Forderungen wie „Ausweitung der individuellen, nicht übertragbaren Elterngeldmonate auf mindestens vier Monate“ und „10 Tage Freistellung für Väter bzw. zweite Elternteile rund um die Geburt mit vollem Lohnersatz“ gehen zwar schon über die im aktuellen Koalitionsvertrag formulierten Vorhaben hinaus, sind aber allenfalls ein erster Schritt dahin, „Care-Bedarfe als grundlegende gesellschaftliche Aufgabe im Zusammenhang wahrzunehmen, statt Einzellösungen zu entwickeln“, wie es 2013 gefordert wurde.
Die Corona Pandemie hat die Schwächen der Care Systeme schonungslos offengelegt. Eine gesellschaftliche Kultur die Sorge für sich und andere einen angemessenen Stellenwert zuweist, ist dennoch nicht in Sicht. Im Gegenteil, vor dem Hintergrund, der durch den russischen Überfall provozierten Energiekrise und der Inflation wird zwar einerseits das Muster männlicher Vollzeittätigkeit als Haupthemmnis identifiziert, das Väter an mehr Familienarbeit hindert. Andererseits aber kommuniziert, dass Wirtschaft mehr ‚Bock auf (Erwerbs-) Arbeit‘ braucht und diejenigen, die Arbeitszeiten reduzieren möchten, mit dem Vorwurf konfrontiert, ‚Arbeit sei kein Ponyhof‘.
Care macht mehr Leben ins Männerleben. Aber dafür braucht es mehr strukturelle Veränderungen, vor allem auch bei den Arbeitszeiten. Ohne eine Reduzierung der Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich ist eine geschlechtergerechte Aufteilung von bezahlter und unbezahlter Arbeit nicht möglich. Don’t fix the (Wo)Men!
Abgelegt unter Krise, Partnerschaft, Rolllenbilder, Visionen | Keine Kommentare »