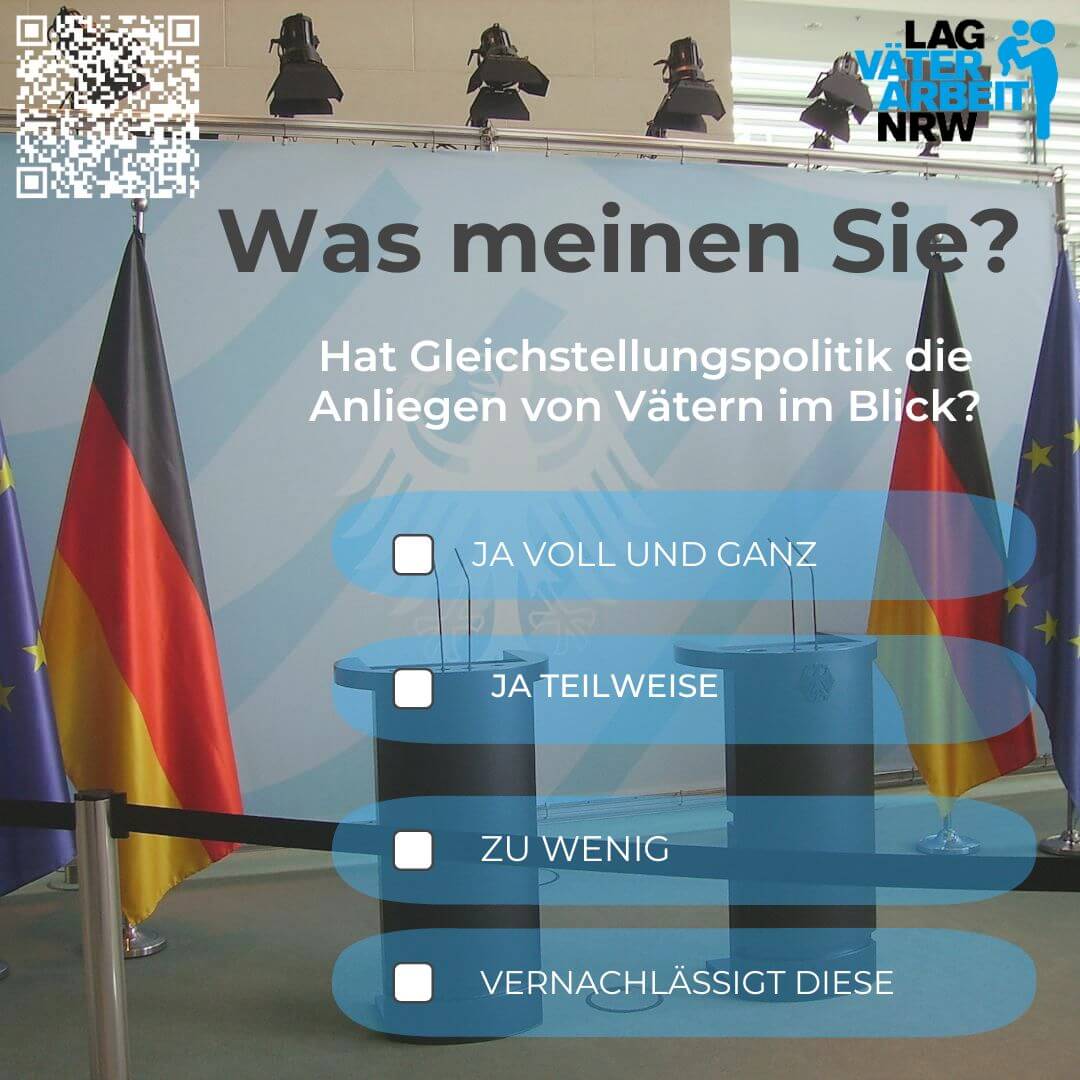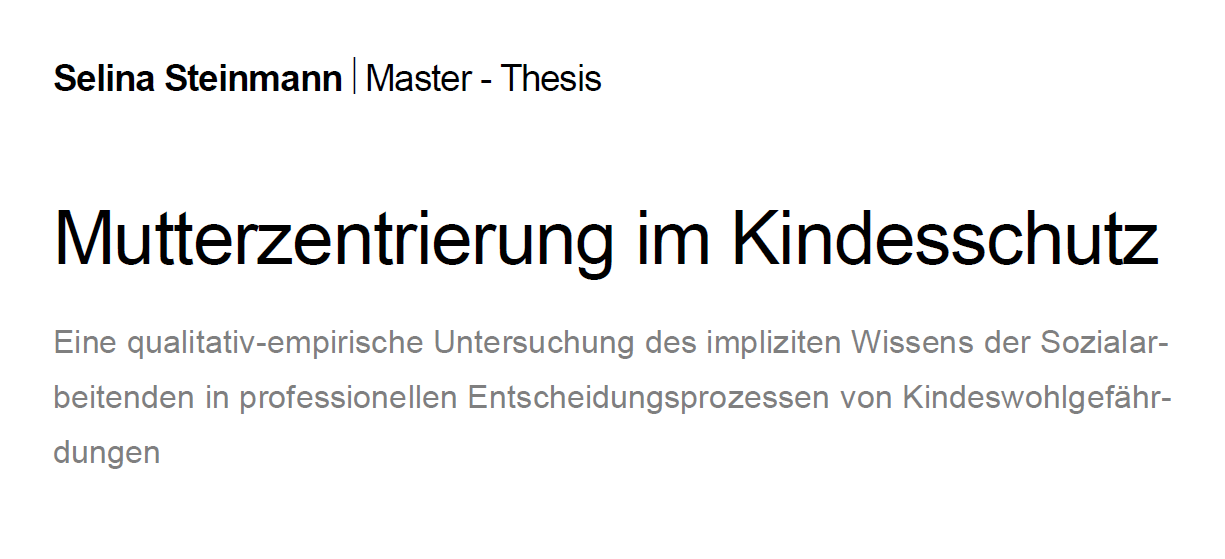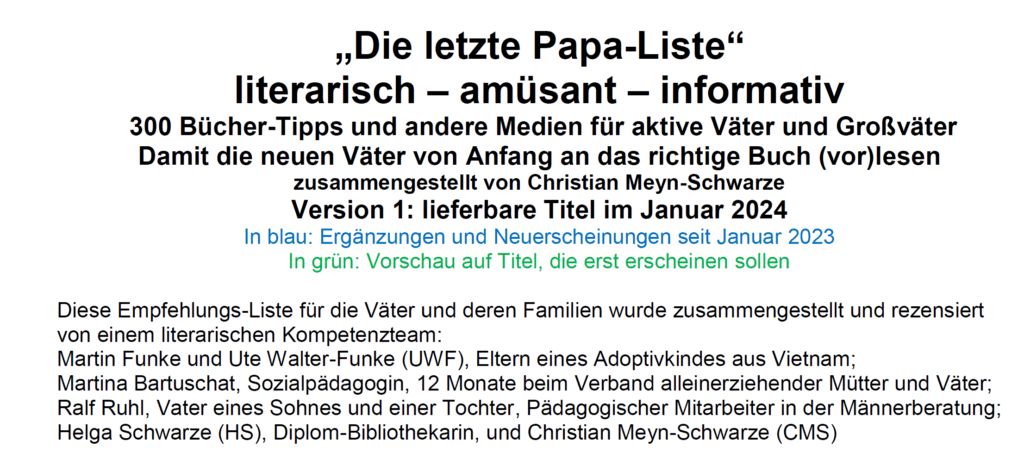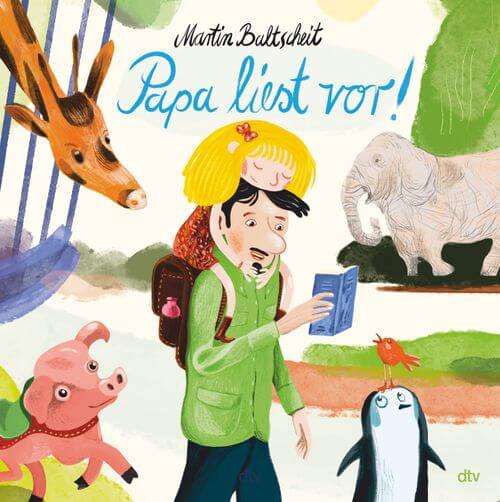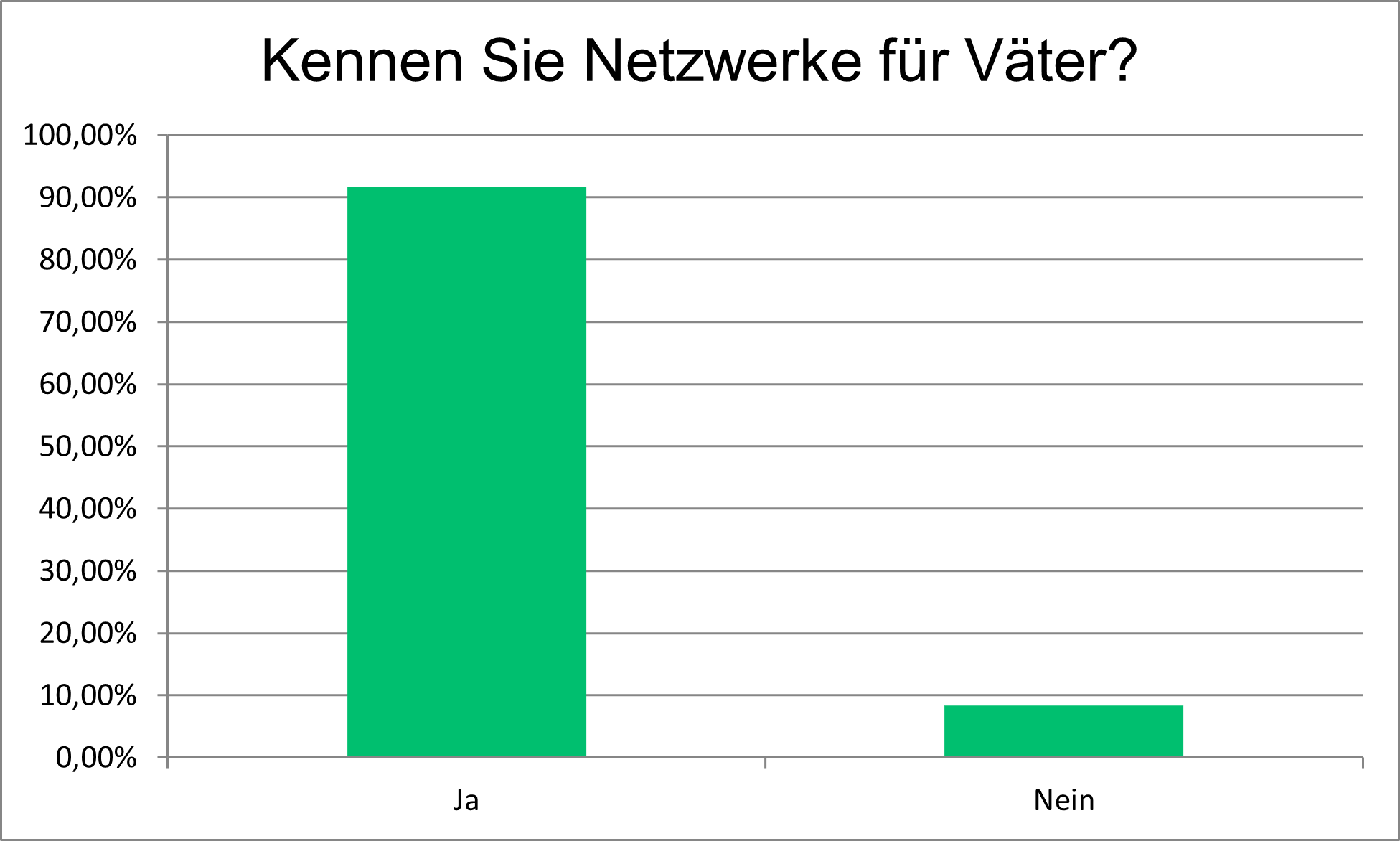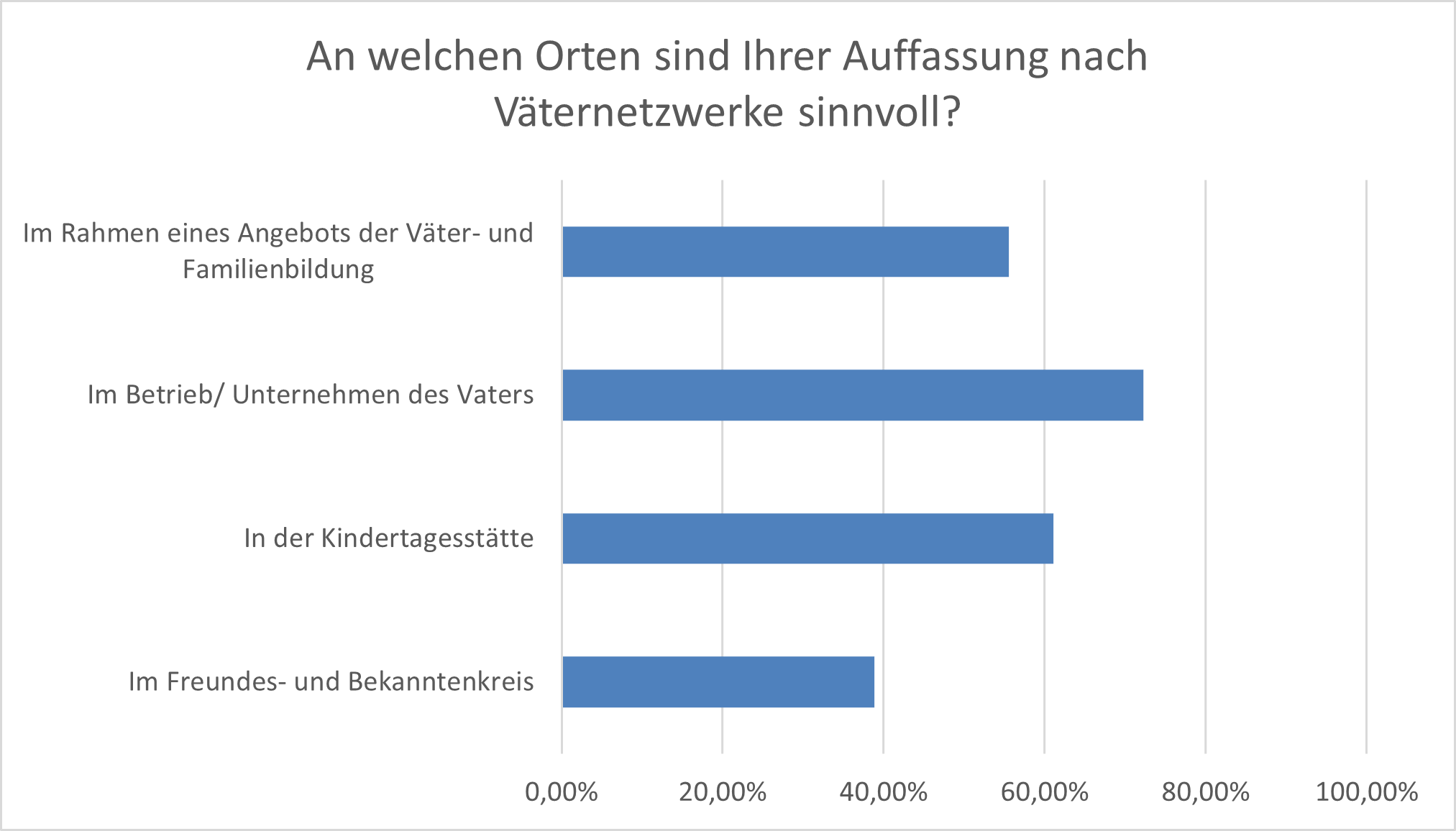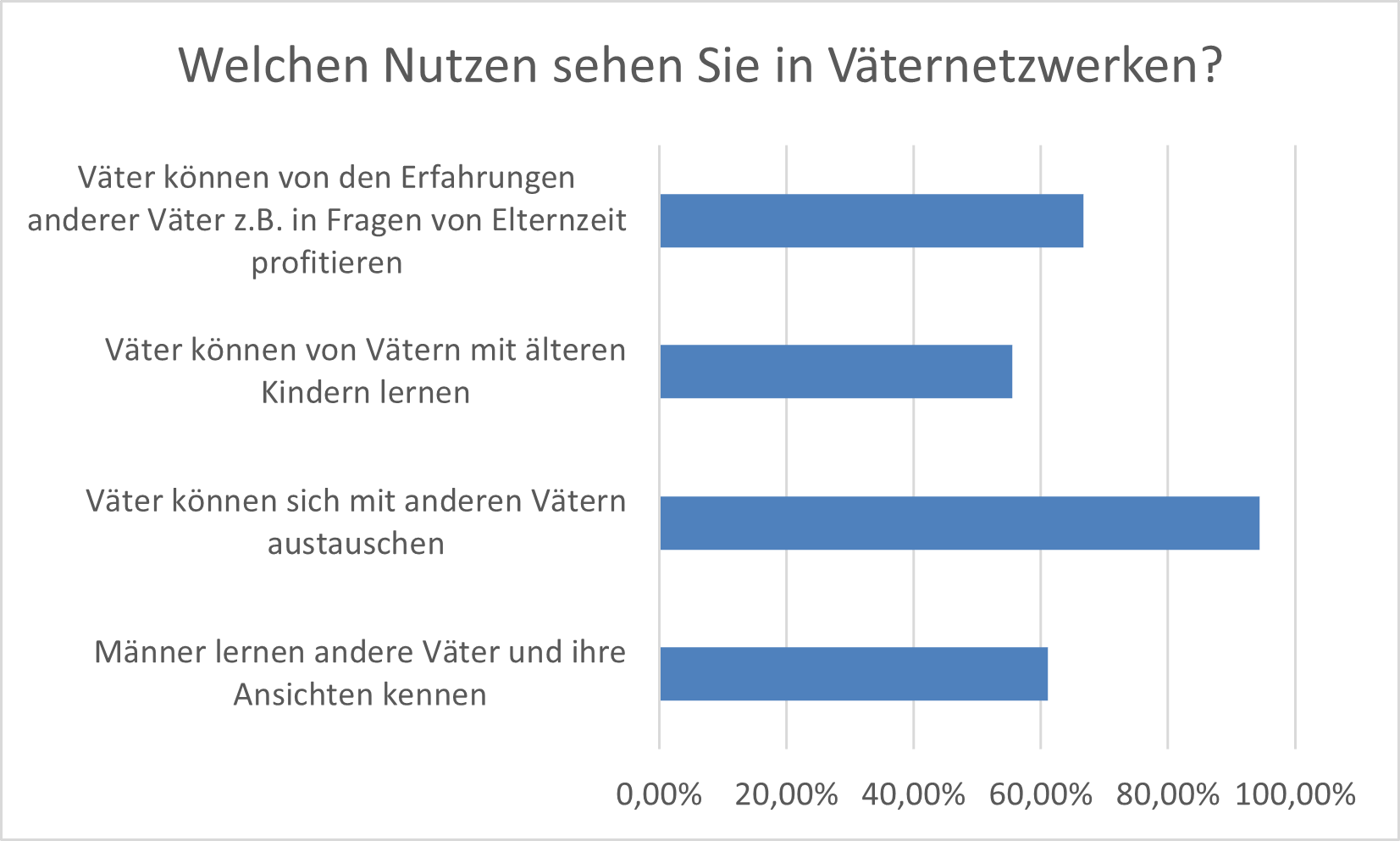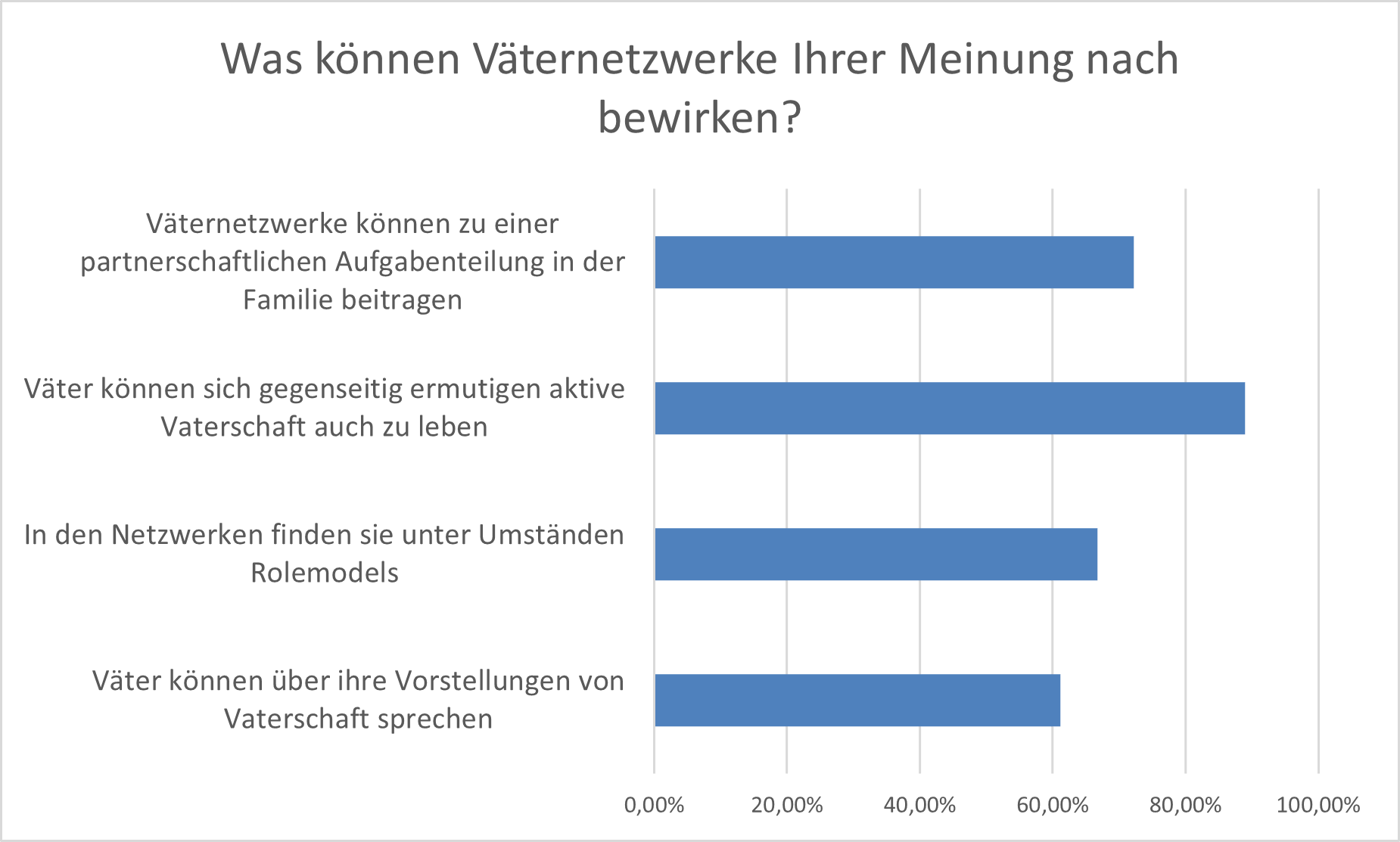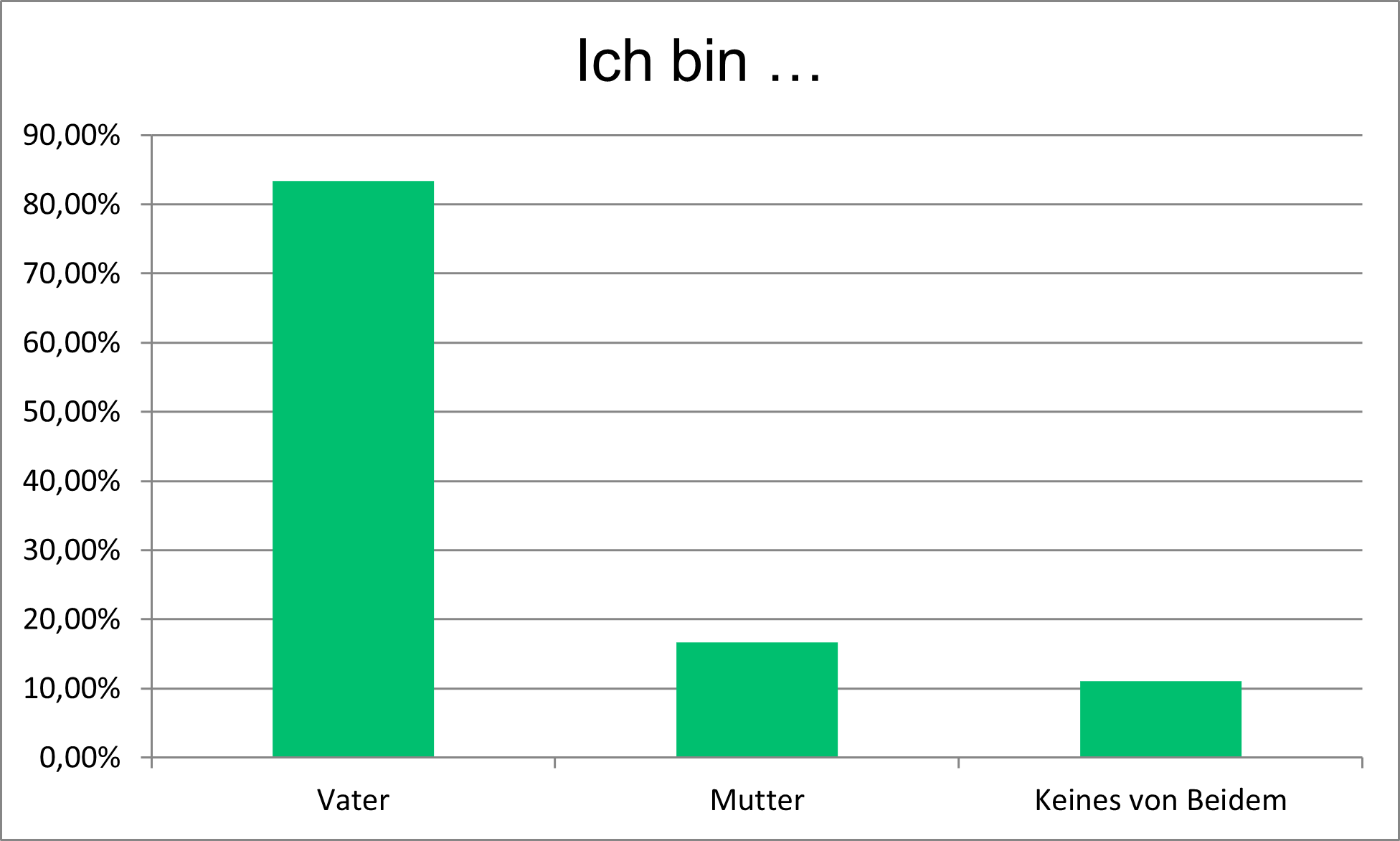Perspektiven von Vätern auf Gleichstellungs- und Familienpolitik
Erstellt von Hans-Georg Nelles am Montag 18. März 2024
… aktuelle Informationen und Termine zur Arbeit mit Vätern
Das neue Jahr ist schon fast drei Monate alt, Ostern und die Zeitumstellung stehen an und die freien Tage können Sie hoffentlich zum Durchatmen nutzen.

Dass dies dringend notwendig ist, zeigt eine
Umfrage im Auftrag der KKH Kaufmännische Krankenkasse. Demnach fühlen sich
aktuell 62 Prozent der Eltern mit minderjährigen Kindern häufig oder sogar sehr
häufig gestresst. Genau zwei Drittel sagen darüber hinaus, der Stress habe in
den vergangenen ein bis zwei Jahren zugenommen.
Eine weitere Folge dieser Entwicklung ist, dass die Geburtenrate von 1,57
Kindern pro Frau im Jahr 2021 auf rund 1,36 im Herbst 2023 gefallen ist. Auch
diese Entwicklung wird mit der Fülle an Krisen und der damit einhergehenden
Verunsicherungen erklärt.
Mit Blick auf Väter beunruhigt uns eine weitere Krise besonders: Im Januar
berichtete die Financial Times, dass Männer zunehmend konservativer wählen. Sie
erleben die Fortschritte in Sachen Geschlechtergerechtigkeit nicht als Chance
und Gewinn für sich, sondern offensichtlich zunehmend als Bedrohung. Dies war
für uns Anlass in der gerade abgeschlossenen Kurzbefragung nach Hintergründen
zu fragen.
Väterperspektiven auf Gleichstellung und Familienpolitik
Beim
nächsten Werkstattgespräch am 11. April, um 15:30 Uhr, werden die Ergebnisse
der Kurzbefragung zu dem Blick von Vätern auf Gleichstellungs- und
Familienpolitik vorstellen.
Der Vorsitzende der LAG-Väterarbeit Hans-Georg Nelles wird gemeinsam mit
Dietmar Fleischer, der im Gleichstellungsbüro der Stadt Essen die Männer- und
Väterbelange vertritt, diese in aktuelle politische Auseinandersetzungen wie
zum Beispiel die ‚Vaterschaftsfreistellung‘ aka Familienstartzeit aber auch in
die Diskussionen um Unterhalts- und Kindschaftsrecht einordnen.
Dabei werden auch andere aktuelle Befragungen wie die von Plan International aus dem Sommer 2023 und Studien wie die vom Bundesforum Männer einbezogen.
Bitte merken Sie den Termin vor oder melden sich jetzt schon hier an.
Familienstartzeit
Die politische Diskussion um die
‚Vaterschaftsfreistellung‘ entwickelt sich zu einer unendlichen Geschichte. Der
Referentenentwurf befindet sich seit über einem Jahr in der Ressortabstimmung.
Um so mehr freuen wir uns darüber, dass Unternehmen von sich aus die Initiative
ergreifen und ihren Beschäftigten diese wichtige Zeit mit den Kindern
ermöglichen.
Gerade hat die Funke Medien Gruppe angekündigt, allen Partner*innen von Müttern
innerhalb der ersten 6 Wochen nach der Geburt 10 Tage Familienstartzeit zu bezahlen.
Zu Beginn des Jahres war Henkel mit dem Angebot von acht Wochen bezahlter
Freistellung ‚vorgeprescht‘. Bei der Lokalzeit des WDR am 25. Januar konnten wir die positiven Wirkungen dieses
Vorhabens erläutern.
Alle Beiträge und weitere Terminhinweise finden Sie auf der Webseite www.lag-vaeterarbeit.nrw
Abgelegt unter Krise, Politik, Rolllenbilder | Keine Kommentare »